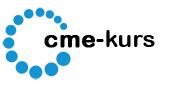Einführung
Die Kardio-CT nimmt insbesondere in der Diagnostik der koronaren Herzkrankheit (KHK) als nicht invasive Untersuchungsmethode eine zunehmend wichtige Bedeutung ein. In der 2019 veröffentlichten Guideline der European Society of Cardiology (ESC) wurde die koronare CT-Angiografie (CCTA) mit einer Klasse-Ib-Empfehlung bei symptomatischen Patienten versehen und ist als initiale Diagnostik durchzuführen, wenn eine KHK nicht durch klinische Assessments allein ausgeschlossen werden kann. Die CCTA ist die präferierte Untersuchung bei geringer bis intermediärer Vortestwahrscheinlichkeit einer KHK sowie bei erwartbar guter Bildqualität. Das lässt sich unter anderem auf den hohen negativen prädiktiven Wert des Verfahrens zurückführen. Darüber hinaus konnte in der SCOT-HEART-Studie gezeigt werden, dass mit der CCTA zusätzlich zur Standardversorgung die Rate an kardialen Ereignissen (zum Beispiel Myokardinfarkt) bei Patienten mit KHK im Vergleich zur Standardversorgung niedriger war. Dazu wurden 4146 Probanden mit stabiler Angina Pectoris (AP) für die Studie rekrutiert. Als primärer Endpunkt wurde nach fünf Jahren der Tod durch KHK oder nicht letale Myokardinfarkte festgelegt. Nach im Median 4,8 Jahren waren in der Kohorte mit Standardversorgung 3,9 % der Patienten verstorben oder hatten einen nicht tödlichen Myokardinfarkt erlitten. In der CCTA-Gruppe lag die Quote nur bei 2,5 %, was einer Risikoreduktion von 40 % entspricht. Daten aus 2022, die ebenfalls im New England Journal of Medicine (NEJM) publiziert wurden, konnten darüber hinaus zeigen, dass bei Patienten, die wegen stabiler AP einer invasiven Herzkatheteruntersuchung (ICA) zugeführt werden sollten, eine nicht invasive diagnostische Strategie mit der CCTA einer initialen ICA nicht unterlegen ist: Das Risiko für große unerwünschte kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) war in der CCTA-Gruppe sogar geringer, wenngleich statistisch nicht signifikant.
Anatomie der Koronararterien
Das Herz wird über die linke (Arteria coronaria sinistra) und die rechte (Arteria coronaria dextra) Koronararterie versorgt. Der Hauptstamm der linken Koronararterie teilt sich im Normalfall in den Ramus interventricularis anterior (RIVA), im Englischen auch als „left anterior descending artery” (LAD) bezeichnet, und den Ramus circumflexus (RCX) beziehungsweise die „left circumflex artery” (LCX) auf. Der RIVA verläuft im Sulcus interventricularis anterior in Richtung Herzspitze. Die rechte Koronararterie entspringt aus dem Sinus aortae dexter und zieht dann in die AV-Grube (Sulcus coronarius dexter).
Indikation
Die vermutete oder bereits bestätigte koronare Herzerkrankung ist die Hauptindikation zur Durchführung einer Herz-CT. Dahinter folgen Klappenerkrankungen wie die Aortenklappenstenose, bei denen kardiochirurgische oder kardiologische Interventionen wie die „transcatheter aortic valve implantation” (TAVI) erfolgen sollen. Die Visualisierung der Pulmonalvenen, beispielsweise vor einer Katheterablation, folgt an dritter Stelle. Die Abklärung von Koronaranomalien, die insbesondere bei jüngeren Patienten relevant ist, stellt eine vergleichsweise seltene Indikation dar.
Rekonstruktion
Bildauflösung
Aufgrund des geringen Durchmessers der Koronararterien (im Abgangsbereich ca. 5 mm) ist die Anwendung von dünnen, in der Regel 0,6 mm breiten Schichten essenziell. Darüber hinaus ist auch der Abstand der Schichten (Inkrement) von Bedeutung. Beim Kardio-CT sollte ein möglichst überlappendes Inkrement verwendet werden, um eine bessere Darstellung zu erreichen. Eine Überlappung von 30 bis 50 % der Schichtdicke wird oft empfohlen. Die Bildqualität kann zusätzlich verbessert werden, indem das „field of view” (FOV) so klein wie möglich eingestellt wird. Das FOV beschreibt den Bildausschnitt der anatomischen Region, die während des Scans untersucht wird. Eine normale Matrixgröße eines CT-Bildes beträgt 512 x 512 Bildpunkte. Geht man von einem üblichen FOV von 50 cm aus, ergibt das eine Pixelgröße von 0,97 mm (500 mm : 512 Pixel = 0,97 mm). Beim Kardio-CT ist es empfehlenswert, ein FOV von ca. 18 cm auszuwählen, sodass eine Pixelgröße von 0,35 mm generiert wird.
Bildeindruck
Der Bildeindruck ist wesentlich von der Auswahl des Kernels abhängig. Ein weicher Kernel ist zur besseren Darstellung von Weichteilkontrasten geeignet, führt aber auch dazu, dass Strukturen mit höherer Dichte, wie zum Beispiel intravasale Kalkplaques, unscharf dargestellt werden. Ein harter Kernel hilft dabei, Plaques besser abgrenzen zu können und die Sicht nach intraluminal zu verbessern. Folglich sollte immer mit beiden Kernels rekonstruiert werden. Ebenso bietet die Anwendung einer iterativen Rekonstruktion hinsichtlich des Bildeindruckes einige Vorteile: Mithilfe der iterativen Rekonstruktion werden repetitiv (iterativ) Korrekturbilder erstellt, bis eine suffiziente Bildqualität erreicht wird. Dadurch kann das Signal-zu-Rausch-Verhältnis verbessert und die Strahlendosis um bis zu 40 % reduziert werden.
Synchronisierung
Ein weiterer wichtiger Parameter bei der Bildrekonstruktion ist die EKG-Synchronisierung. Dieser Prozess dient dazu, die Herzbewegungen zu kompensieren. Für die Auswahl eines geeigneten Zeitfensters zur Datenrekonstruktion muss unbedingt die Herzfrequenz berücksichtigt werden. Liegt eine niedrige Herzfrequenz vor (<70 bpm), stellt die Enddiastole die ruhigste Herzphase dar. Bei einer Herzfrequenz >80 bpm sind weniger Bewegungsartefakte in der Endsystole zu erwarten. Auf dieser Grundlage kann die geeignete EKG-Synchronisierung erfolgen. Man unterscheidet zwischen absoluten und relativen Verfahren. Bei niedrigen Herzfrequenzen bietet sich die Nutzung der relativen EKG-Synchronisierung an. Zur Bilddatenrekonstruktion wird dabei ein Zeitfenster ausgewählt, das sich in einem RR-Intervall des EKGs befindet. Zur enddiastolischen Rekonstruktion wird üblicherweise ein Zeitpunkt gewählt, der sich bei 70 % des RR-Intervalls befindet. Man spricht in dem Fall von einem relativen Delay von 70 %. Die Nutzung einer absolut antegraden Rekonstruktion eignet sich bei hoher Herzfrequenz, absoluter Arrhythmie oder wenn der Versuch mit einem relativen Delay frustran verläuft. Bei diesem Verfahren wird der Bildrekonstruktionszeitpunkt als absoluter Zeitpunkt nach einer R-Zacke (R + ms) angegeben. Durch diese Modifikation kann z. B. das Bild in der Endsystole rekonstruiert werden, was bei genannten Zuständen vorteilhaft ist, weil die Dauer der Systole nahezu konstant bleibt, während sich die Dauer der Diastole stark verändert. Die Nutzung eines absoluten Delays von R + 300 ms ist dabei üblich.
Korrekturen
Eine absolute Arrhythmie mit einer hohen Herzratenvariabilität kann die Bildqualität, zum Beispiel durch die Entstehung von Bewegungsartefakten, massiv verschlechtern. Dadurch können retrospektive Korrekturen notwendig werden, um dennoch diagnostische Aussagen über die Koronararterien treffen zu können. Bei fokalen Problemen, wie singulären Bewegungsartefakten, kann es ausreichend sein, das Delay zu verschieben: Wurde initial ein Rekonstruktionszeitpunkt von R + 300 ms verwendet, kann dieser weiter nach vorn oder hinten verschoben werden, zum Beispiel R – 250 ms. Bei absoluter Arrhythmie sind häufig weitere manuelle Anpassungen notwendig. Kommt es etwa zu Extrasystolen, müssen diese selektiv herausgelöscht werden. Dies ist allerdings nur möglich, wenn die unterschiedlichen Herzphasen im Spiralmodus auch akquiriert werden. Durch Modulation des Röhrenstromes während der Bewegungsphasen des Herzens (EKG-Pulsing) kann die Bildqualität in den angepassten Zeitpunkten reduziert sein. Wurden prospektiv getriggerte Sequenzen aufgenommen, können die Anpassungen ausschließlich in engen Bereichen um den Triggerpunkt oder bei sehr engen Akquisitionsfenstern gar nicht angepasst werden. In der prospektiven Akquisition im sequenziellen Modus können zudem Artefakte durch die überlappende Rekonstruktion benachbarter Detektorpositionen in der Körperlängsachse entstehen. Diese können wegen des engen Aufnahmefensters zwar meist nicht mehr korrigiert, durch eine Rekonstruktion ohne Verrechnung der Überlappungsbereiche zwischen den sequenziellen Aufnahmen („true stack”-Rekonstruktion) jedoch detektiert und reduziert werden. In den Serien muss nun nach überlagerungsfreien Bildern der einzelnen Koronararteriensegmente gefahndet werden. Im Verlauf erhält man so eine artefaktfreie Darstellung der Gefäße in Form von Einzelbildern.
Darstellung
Die Möglichkeiten der Darstellung sind mannigfaltig. Im Folgenden soll auf die wichtigsten Modi eingegangen werden.
Maximumintensitätsprojektion (MIP)
Die MIP arbeitet nur die Regionen mit den höchsten Dichtewerten innerhalb des Datensatzes heraus und eignet sich daher gut als initiale Übersichtsaufnahme zur Analyse der anatomischen Verhältnisse sowie zur schnellen Detektion von Pathologien. Auch Fremdmaterialien wie Stents können zügig erfasst werden. Durch das Übereinaderprojizieren von Gefäßen in der MIP ist das entstehende Bild der konventionell angiografischen Darstellung sehr ähnlich. Liegt eine hypodense, also nicht verkalkte Plaque vor, ist die MIP darüber hinaus eine gute Rekonstruktion zur Stenosebeurteilung. Bei hyperdensen Plaques ist die MIP hingegen aufgrund der Projektionsdarstellung nicht geeignet, um Stenosegrade zu evaluieren, weil Verkalkungen auf das Lumen projiziert werden und somit hochgradige Stenosen imitiert werden können.
Multiplanare Reformation (MPR)
MPR beschreibt den Prozess, eine Aufnahme in einer beliebigen Ebene zu betrachten. Dadurch kann eine anatomische Region beispielsweise von axial, koronal und sagittal, aber in beliebigen schrägen Reformationen betrachtet werden. Die MPR eignet sich daher zur Detaildarstellung. Zur Beurteilung der MPR müssen die richtigen Fenstereinstellungen, also Fensterzentrum und Fensterweite, vorbereitet werden. In der Literatur finden sich folgende Empfehlungen:
- Fensterweite W = mittlere Dichte in den Koronararterien (HU, Hounsfield Units) x 2 (typisch: 700 bis 1000)
- Fensterzentrum C = mittlere Dichte in den Koronararterien (HU) x 0,7 (typisch: 200)
Wurde das richtige Fenster eingestellt, sind weitere manuelle Einstellungen erforderlich. Dazu stellt man das zu untersuchende Gefäß dar, legt das Lot in das Gefäß und erhält dann eine auf das jeweilige Gefäß angepasste MPR, in der der Stenosegrad besser beurteilt werden kann. Durch Zoomen kann die Aussagekraft zusätzlich verbessert werden.
Gekrümmte MPR
Die gekrümmte oder auch „curved” MPR wird häufig von Programmen und Scannern angeboten. Diese spezielle MPR bietet die Möglichkeit, den Verlauf der gesamten Koronararterie in einer Ebene darzustellen. Dazu eignet sich am besten die Einzelrekonstruktion der Herzphase mit dem größten Durchmesser der koronaren Gefäße und den wenigsten Bewegungsartefakten. Dann wird automatisch oder manuell eine Mittellinie („centre line”) in das Lumen des Gefäßes gelegt, auf dessen Basis eine gekrümmte MPR erstellt werden kann. Durch die langstreckige Abbildung der Koronararterien ist die „curved” MPR eine sehr gute Übersichtsaufnahme. Es ist jedoch zu beachten, dass Stenosen immer in zwei orthogonal zueinander angeordneten Schichten untersucht werden müssen. Des Weiteren sollte die gekrümmte MPR nicht als einziges Reformationsverfahren, sondern immer nur in Kombination, zum Beispiel mit der konventionellen MPR, genutzt werden.
Volumenrekonstruktion (VRT)
Die VRT ist eine dreidimensionale Darstellung, für die der ganze Datensatz verwendet wird und jedem Dichtewert eine Farbe und eine Transparenz zugeordnet werden. Hauptanwendungsgebiet der VRT ist die Befunddemonstration: Auf der einen Seite profitieren Patienten von der Darstellung, um ein besseres Verständnis für ihre Erkrankung zu erlangen. Auf der anderen Seite ist die Rekonstruktion für die Kardiochirurgie relevant, weil anatomische Strukturen sowie deren Verlauf dreidimensional dargestellt werden und auf Basis dieser Kenntnis Eingriffe besser geplant werden können. Bei der Diagnostik von Stenosen und Plaques spielt die VRT indes keine Rolle. In Studien konnte gezeigt werden, dass die Genauigkeit der Volumenrekonstruktion bei der Erkennung von Stenosen der Koronararterien Defizite aufweist: Die Sensitivität liegt bei nur 61 %, die Genauigkeit („accuracy”) bei 72 %. Zum Vergleich: Sensitivität und „accuracy” liegen bei der besten Methode, der „free oblique” MPR, bei 91 %.
Auswertung
Bei der Auswertung eines Kardio-CTs ist eine strukturierte und standardisierte Auswertung essenziell. Dabei ist auf folgende Punkte zu achten:
- 1. Bildqualität
- 2. Koronaranomalien
- 3. Koronarer Versorgungstyp
- 4. Quantifizierung der Stenose
- 5. Plaquebeurteilung
- 6. Nebenbefunde
- 7. Gesamtbeurteilung nach CAD-RADS
Bildqualität
Zu Beginn einer strukturierten Auswertung ist auf eine diagnostische Bildqualität zu achten. Diesbezüglich existieren drei Abstufungen: gut, reduziert, aber diagnostisch, und nicht diagnostisch. Einen möglichen Störfaktor der Bildqualität stellen beispielsweise Bewegungsartefakte dar, die sich als Unschärfe, Doppelungen und als Kombination aus Schwächungsanhebungen und -absenkungen manifestieren können. Sind die Koronararterien weiterhin beurteilbar, ist die Bildqualität reduziert, aber noch diagnostisch. Zeigen sich Doppelkonturen der Gefäßwände oder imponieren die koronaren Gefäße nur noch als „Kometenschweif”, ist von einer nicht diagnostischen Bildqualität auszugehen. Auch der Kontrast bestimmt maßgeblich die Bildqualität. Grenz- und Zielwerte für das intrakoronare Kontrastmittel-Enhancement werden in der Wissenschaft kontrovers diskutiert; bei Dichtewerten von über 300 HU ist grundsätzlich von einer guten Bildqualität auszugehen. Weniger als 300 HU gehen mit einer reduzierten oder nicht diagnostischen Bildqualität einher. Einige Autoren sehen auch Dichtewerte über 700 Houndsfield-Einheiten als kritisch an. Durch Modifikationen der Fenstereinstellungen kann eine Differenzierung von Plaque und Kontrastmittel erfahrungsgemäß auch bei solch starkem Enhancement dennoch gut gelingen.
Koronaranomalien
Koronaranomalien („anomalous origin of coronary arteries”, AOCA) sind seltene Abgangsvarianten der Koronararterien und bleiben häufig ein Leben lang asymptomatisch. Es existieren allerdings auch Hochrisikovarianten, die eine häufige Ursache für einen plötzlichen Herztod bei jungen Athleten darstellen. Koronaranomalien können auf Grundlage des Ursprunges und des Verlaufes des Gefäßes klassifiziert werden: Es existieren interarterielle (zwischen Aortenwurzel und Truncus pulmonalis), retroaortale und präpulmonale Verläufe. Bei retroaortalen und präpulmonalen Verläufen ist von einer eher „benignen” Konstellation auszugehen, während interarterielle Varianten durch die potenzielle Gefahr der Kompression als „maligne” einzustufen sind und mit einem höheren Risiko für myokardiale Ischämie, ventrikuläre Arrhythmien und plötzlichen Herztod vergesellschaftet sind.
Koronarer Versorgungstyp
Auch die Bestimmung des koronaren Versorgungstyps ist von Bedeutung: Es lassen sich drei Konstellationen unterscheiden: ausgeglichener, Links- oder Rechtsversorgungstyp. Der ausgeglichene Versorgungstyp liegt bei etwa 70 % der Menschen vor. In dem Fall erfolgt die Perfusion der Herzhinterwand zu etwa gleichen Teilen aus der linken und der rechten Koronararterie. Dabei geht der R. interventricularis posterior aus der A. coronaria dextra hervor, während der R. posterolateralis sinister aus dem R. circumflexus der A. coronaria sinistra entspringt. Das Reizleitungssystem (Sinusknoten, AV-Knoten, His-Bündel) wird dabei durch die RCA versorgt, weshalb es bei Stenosen der rechten Koronararterie zu Rhythmusstörungen kommen kann. Beim Linksversorgungstyp, der mit einer Häufigkeit von 15 % vorkommt, wird nicht nur der R. posterolateralis sinister, sondern auch der R. interventricularis posterior über die RCX versorgt. Vice versa wird beim ebenso häufigen Rechtsversorgungstyp die Herzhinterwand neben dem R. interventricularis posterior mit einem stark ausgeprägten R. posterolateralis dexter aus der RCA versorgt.
Quantifizierung der Stenose
Die Beurteilung der Stenosegrade erfolgt in mehreren Abstufungen. Hierbei sind insbesondere die moderaten, hochgradigen und vollständigen Stenosen relevant, weil dann eine weitere Feindiagnostik, zum Beispiel durch Kathetergestützte Koronarangiografie, angezeigt ist. Plaquebesatz mit Stenosegraden unter 50 % sind auch zu dokumentieren, allerdings in erster Linie, damit die Patienten einer medikamentösen Therapie zugeführt werden können. Der visuelle Eindruck ist bei der Stenosequantifizierung der Nutzung von ausführlichen Messverfahren vorzuziehen. Im Rahmen einer fortgeschrittenen Atherosklerose kommt es häufig zu einer Erweiterung (positives Remodeling) oder Verschmälerung (negatives Remodeling) des Gefäßdurchmessers. Daher gelingt es oft auch nach Einstellung eines harten Kerns nicht, die Gefäßwände darzustellen, woraus ungenaue und auch untersucherabhängige Messungen mit einer hohen Varianz resultieren können. Es ist weiterhin zu beachten, dass insbesondere Stenosen in peripheren koronaren Gefäßsegmenten in der Computertomografie tendenziell überschätzt werden.
Plaques
Die Auswertung eines Kardio-CTs beinhaltet auch die Fahndung nach Plaques sowie – sofern vorhanden – die Beurteilung deren Morphologie. Dabei ist auf unterschiedliche Vulnerabilitätskriterien zu achten. Nicht verkalkte Plaques imponieren hypodens im Vergleich zum umliegenden Gewebe, was auf die lipidhaltige Grundstruktur (Cholesterol) zurückzuführen ist. Man spricht in dem Fall auch von dem Vulnerabilitätskriterium „low attenuation”, weil die Röntgenstrahlung durch die fehlende Verkalkung nur wenig abgeschwächt wird. Um den Begriff „low attenuation” nutzen dürfen, muss die Dichte der Plaques <30 HU betragen. Auch punktförmige Verkalkungen („spotted calcification”) stellen ein Vulnerabilitätskriterium dar. Gleiches gilt für das „napkin-ring-sign”, bei dem die Plaque von einer hyperdensen Hülle umgeben ist. Des Weiteren ist auf das positive Remodeling zu achten. Bei der abschließenden Beurteilung ist dann insbesondere die Anzahl der Vulnerabilitätszeichen relevant. Das Vorhandensein von vulnerablen Plaques erhöht das Risiko für ein akutes Koronarsyndrom unabhängig vom Stenosegrad.
Nebenbefunde
Nicht selten finden sich in der CT-Koronarangiografie Nebenbefunde, die zu dokumentieren sind. Das können beispielsweise Thromben im linken Vorhofohr oder ein Herzspitzenaneurysma im linken Ventrikel sein. Gibt es koronare Bypässe, ist darauf zu achten, dass der Abgang miterfasst wird, um das Bypassgefäß vollständig beurteilen zu können. Nicht selten befindet sich metallhaltiges Clipmaterial neben dem Gefäß, sodass durch die entstehenden Aufhärtungsartefakte in der Übersichtsaufnahme Stenosen im Bypassgefäß imitiert werden können. Die vermeintlichen Stenosen können ausgeschlossen werden, indem die MPR genutzt wird, um die Abschnitte des Bypassgefäßes manuell und kontinuierlich einzustellen. Die Sensitivität der CT-Angiografie liegt dabei bei 100 %, die Spezifität bei 94 %. Bei einliegendem Stentmaterial ist die häufigste Komplikation eine In-Stent-Restenose, die in der Regel in den ersten neun Monaten nach Implantation mit einer kumulativen Inzidenz von 1,3 bis 1,7 % auftritt. „Blooming”-Artefakte durch das Metall der Stents können die Darstellung erschweren. Um diese zu minimieren, ist es empfehlenswert, einen kantenanhebenden Faltungskern zu nutzen. Durch Anwendung einer weiten Fenstereinstellung, wie z. B. des Knochenfensters, kann häufig auch das Stentlumen besser eingesehen werden. Des Weiteren ist es wichtig, den Stentdurchmesser bei der Interpretation zu berücksichtigen. Stents mit einem Durchmesser von <3 mm, die üblicherweise in den mittleren und distalen Abschnitten des koronaren Stromgebietes angewendet werden, können in der CT-Koronarangiografie in der Regel nicht gut beurteilt werden. Hat der Stent einen Durchmesser >3 mm, ist von einer guten diagnostischen Aussagekraft auszugehen.
Gesamtbeurteilung nach CAD-RADS
Ähnlich wie für die radiologische Beurteilung der Mamma (BI-RADS) oder der Prostata (PI-RADS) wurde auch für das Herz ein Scoringsystem entwickelt. Zur Einteilung in die sechs Kategorien der Klassifikation wird vor allem der Stenosegrad im koronaren Stromgebiet berücksichtigt. Durch weitere Zusätze („modifiers”) können unter anderem das Vorhandensein von vulnerablen Plaques (V) oder Stents (S) vermerkt werden. Um den „modifier V” anwenden zu dürfen, müssen mindestens zwei der Vulnerabilitätskriterien vorliegen. CAD-RADS hat neben der Funktion als Klassifikationssystem auch einen prognostischen Wert: Mit steigendem CAD-RADS-Score nimmt auch das Risiko für MACE proportional zu. 2022 wurde mit CAD-RADS 2.0 von der SCCT (Society of Cardiovascular Computed Tomography) eine Weiterentwicklung der aktuellen Kriterien vorgestellt. Die größte Änderung stellt die Implementierung von drei neuen „modifiers” dar. Der Zusatz „P” ist für die Bestimmung der Plaquelast („plaque burden”) relevant. Hier kann visuell auf einer Skala von P1 bis P4 bestimmt werden, wie viele Gefäße in welchem Ausmaß von Plaques betroffen sind. Zur Vergabe des „modifiers I” (Ischämie) ist die Durchführung einer CT-Perfusion (CT-P) oder einer CT mit fraktioneller Flussreserve (CT-FFR) Voraussetzung. Unter „E” können Ausnahmen wie Koronaranomalien vermerkt werden.
Fazit
- Nutzen Sie bei der Rekonstruktion zwei Kernel, um den Bildeindruck und damit die diagnostische Aussagekraft zu verbessern.
- Die „curved” Darstellung eignet sich sehr gut als Übersicht.
- Axiale Ansichten der Koronararterien sollten genutzt werden, um Plaques zu evaluieren.
- Die MPR in drei Ebenen mit zusätzlichen manuellen Anpassungen ist die Methode der Wahl zur definitiven Beurteilung.
- Die CCTA neigt dazu, Stenosen in distalen Gefäßabschnitten zu überschätzen.
- Eine strukturierte Befundung ist die Basis für eine gute Diagnostik.
- CAD-RADS hat neben der Funktion als Klassifikationssystem auch einen prognostischen Wert.
Bildnachweis
kwanchaift – stock.adobe.com